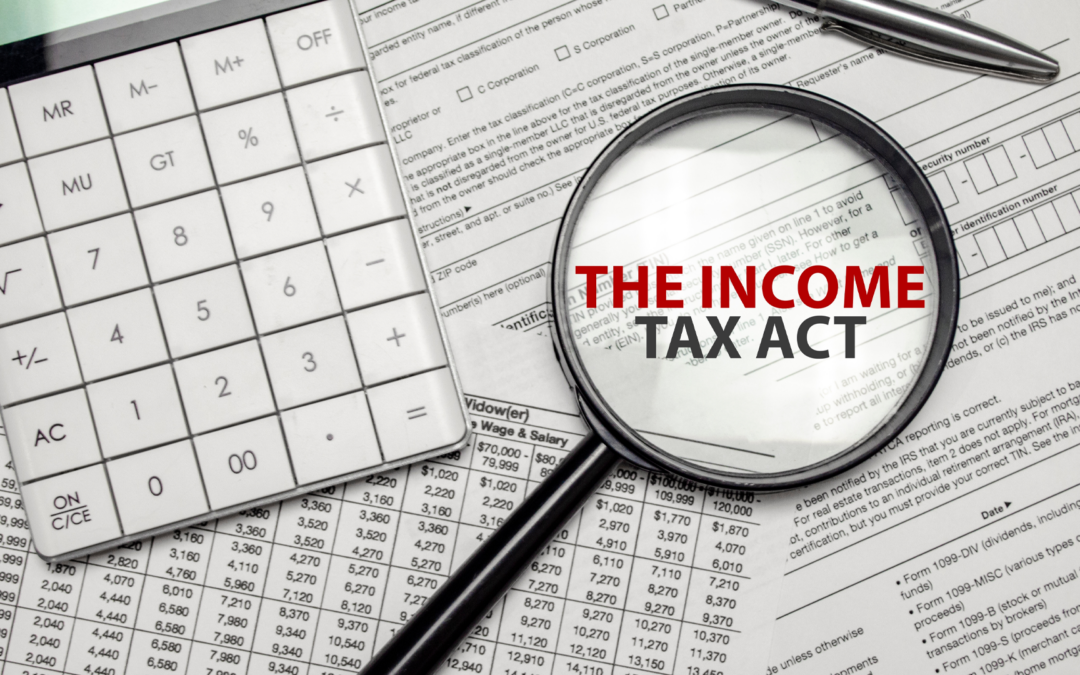Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 06.08.2025 den Referentenentwurf einer „Siebten Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen“ veröffentlicht. Hinter diesem sperrigen Titel verstecken sich u.a. höchst praxisrelevante Änderungen der Durchführungsverordnung zum Einkommensteuergesetz (EStDV).
Eigenbetrieblich genutzte Grundstücksteile von untergeordnetem Wert (§ 8 EStDV)
Aktuelle Regelung
Gegenwärtig brauchen Steuerpflichtige nach § 8 EStDV eigenbetrieblich genutzte Grundstücksteile nicht als Betriebsvermögen steuerlich zu behandeln, soweit deren Wert nicht mehr als ein Fünftel des gemeinen Wertes des gesamten Grundstücks (relative Grenze) und nicht mehr als 20.500 EUR (absolute Grenze) beträgt.
Die Wertgrenze von 20.500 EUR ist hierbei nicht mehr zeitgemäß und führt rglm. dazu, dass das Wahlrecht des § 8 EStDV für Steuerpflichtige bspw. mit einem betrieblichen Arbeitszimmer ins Leere läuft.
Beispiel
In der Eigentumswohnung, die eine Wohnfläche von 100 m2 aufweist, befindet sich ein 10 m2 großes Arbeitszimmer der Selbständigen S.
Während die relative Grenze von einem Fünftel der Gesamtwohnfläche vorliegend nicht überschritten wird (10/100) dürfte es in der Praxis dennoch zu einer verpflichtenden Zuordnung des Arbeitszimmers (nicht der gesamten Wohnung!) zum Betriebsvermögen des S kommen, es sei denn die absolute Wertgrenze von 20.500 EUR wird nicht überschritten. Das hieße aber auch: Die Wohnung darf einen aktuellen Verkehrswert von 205.000 EUR nicht übersteigen – eine unrealistische Annahme bei den aktuellen Grundstückspreisen.
Folge: Das Arbeitszimmer wäre somit als Betriebsvermögen zu aktivieren. In den Fällen einer
- Betriebsveräußerung oder -aufgabe,
- Grundstücksveräußerung oder
- zukünftigen Privatnutzung des Raums
müsste S die anteiligen stillen Reserven (= 10 % der Wohnung) als betriebliche Einkünfte versteuern.
Geplante Neuregelung ab 2026
Nunmehr soll § 8 EStDV ab dem Jahr 2026 zeitgemäß wie folgt angepasst werden:
„Eigenbetrieblich genutzte Grundstücksteile brauchen nicht als Betriebsvermögen behandelt zu werden, wenn ihre Größe nicht mehr als 30 Quadratmeter oder ihr Wert nicht mehr als 40.000 EUR beträgt.“
Die relative Grenze von „ein Fünftel des gemeinen Werts des gesamten Grundstücks“ wird also durch eine fixe Flächengrenze von 30 m2 ersetzt. Nur in den Fällen, in denen diese Grenze überschritten wird, ist in einem zweiten Schritt die Prüfung anhand der absoluten Wertgrenze i. H. von 40.000 EUR erforderlich.
In dem obigen Beispiel hieße dies: Das Arbeitszimmer bräuchte ab dem Jahr 2026 nicht mehr als Betriebsvermögen des S ausgewiesen werden, da die maximale Quadratmeterzahl nicht überschritten wird. Auf den anteiligen Verkehrswert kommt es somit nicht (mehr) an.
Beachten Sie: Eine Entnahme aus dem Betriebsvermögen wäre für S nicht zwingend, es sei denn, eine Nutzungsänderung würde zu notwendigem Privatvermögen führen.
Nimmt S ab dem Jahr 2026 von dem Wahlrecht des § 8 EStDV Gebrauch, darf sie entsprechende Aufwendungen die auf das Arbeitszimmer entfallen nicht mehr als Betriebsausgaben geltend machen, betriebsbezogenen Aufwendungen wie beispielsweise Strom und Heizkosten würden jedoch weiterhin abzugsfähig bleiben. Daneben müsste S die stillen Reserven im Arbeitszimmer aufgrund der entsprechenden Entnahme ins Privatvermögen versteuern.
Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für bebaute Grundstücke
Haben Vertragsparteien für ein bebautes Grundstück einen Gesamtkaufpreis gezahlt, ohne dass die Vertragsparteien eine Aufteilung des Kaufpreises im Kaufvertrag vorgenommen haben, ist der Kaufpreis zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Gebäude-AfA im Schätzungswege aufzuteilen.
Nicht zulässig ist hierbei die „Praktiker-Methode“ bei der der Gebäudewertanteil durch Abzug des Bodenwerts vom Kaufpreis des bebauten Grundstücks ermittelt wird. Denn nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) ist die Aufteilung ausschließlich nach dem Verhältnis der Verkehrswerte oder Teilwerte auf den Grund und Boden einerseits sowie das Gebäude andererseits zulässig.
In der Praxis führt dies rglm. zu Streitfällen mit den Finanzämtern. Diese ermitteln den Gebäudeanteil mit Hilfe einer Arbeitshilfe (sog. Excel-Tool) welche oftmals einen sehr hohen Grund- und Bodenanteil ermittelt und somit den (abschreibungsfähigen) Gebäudeanteil deutlich mindert.
Ab dem Jahr 2026 wird diese Arbeitshilfe nun in den Rang eines Sachverständigengutachtens gehoben, d. h. die aus dem Excel-Tool resultierenden Werte sind im Rahmen der Aufteilung eines Gesamtkaufpreises als verbindlich einzustufen.
Der Aufteilungsmaßstab des Finanzamts mittels der Arbeitshilfe kann durch den Steuerpflichtigen nur durch Vorlage eines für diesen Zweck nach persönlicher Vorortbesichtigung erstellten Gutachtens eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken widerlegt werden.
Achtung: Die Objekte sind von Sachverständigen im Rahmen der Gutachtenerstellung höchstpersönlich zu besichtigen. Der Ortstermin ist entscheidender Bestandteil des Auftrages. Daher ist der Sachverständige nicht befugt, den Ortstermin auf einen anderen zu übertragen!
Praxishinweis: Sofern eine Kaufpreisaufteilung im Kaufvertrag vorgenommen wird, ist diese zunächst maßgeblich, allerdings muss diese nicht zwingend von der Finanzverwaltung übernommen werden. Denn handelt es sich dabei nur um eine „Scheinvereinbarung“ ist das Finanzamt an diese Aufteilung nicht gebunden. Dennoch sollte in allen Immobilien-Kaufverträgen darauf geachtet werden, dass eine klare Aufteilung in einen Grund und Boden- sowie einen Gebäudeanteil verbindlich vereinbart wird. Sind hierbei die realen Wertverhältnisse nicht in grundsätzlicher Weise verfehlt, ist das Finanzamt auch an diese Kaufpreisaufteilung gebunden.
Nachweis einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer eines Gebäudes
Die (Rest-)Nutzungsdauer eines Gebäudes wird durch feste Abschreibungssätze (bspw. 3 % bei Wohngebäuden entspricht einer Nutzungsdauer von 33 1/3 Jahren). Diese Vereinfachung ist grundsätzlich auch bei erworbenen Bestandsimmobilien maßgebend. Ist in diesen Fällen die tatsächliche Restnutzungsdauer der Immobilie jedoch (deutlich) kürzer, hat der Steuerpflichtige die Möglichkeit, dieses dem Finanzamt gegenüber nachzuweisen, so dass sich die Abschreibung des Gebäudes dann nach eben dieser tatsächlich kürzeren Nutzungsdauer ermittelt und somit das Gebäude „schneller“ abgeschrieben werden kann.
Nunmehr soll die Verordnung ab dem Jahr 2026 klar und verbindlich regeln, wie dieser Nachweis durch den Steuerpflichtigen zu erfolgen hat:
- der Nachweis muss zwingend durch ein Sachverständigengutachten gem. § 4 Abs. 3 der Immobilienwertermittlungs-verordnung (ImmoWertV) erfolgen;
- Die Objekte sind von Sachverständigen höchstpersönlich zu besichtigen (Ortstermin zwingend);
- Das Gutachten muss durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken im Sinne der §§ 36, 36a GewO erstellt werden.
Praxishinweise: Gutachten durch nicht-sachverständige Personen oder einfache „Internetgutachten“ werden schon aktuell durch die Finanzämter nicht zum Nachweis einer kürzeren Restnutzungsdauer anerkannt, ab 2026 wird diese Auffassung auch in der EStDV festgeschrieben.
Dies erhöht für Steuerpflichtige die Anforderungen und die Kosten eines solchen Nachweises erheblich. Hier ist die Kosten-Nutzen-Relation sorgfältig abzuwägen.
Eine Ausnahme gilt bei besondere Betriebsgebäuden (beispielsweise Hallen in Leichtbauweise, Schuppen). Für diese kann eine kürzere Nutzungsdauer angenommen werden, ohne dass hierfür eine gesonderte Nachweispflicht besteht. Die Finanzverwaltung hat hier gesonderte Afa-Tabellen veröffentlicht, welche als Richtwerte von der Änderung der EStDV nicht betroffen sind.